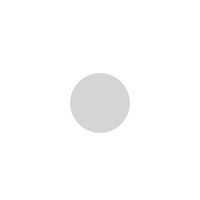Prävention im Fokus: Update 2021
Bei einem Mittagssymposium im Rahmen der virtuellen DDG berichtete Prof. Mark Berneburg (Regensburg) über aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung bezüglich Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Hautkrebs.
„Uns ist bekannt, dass direkt auf die Haut einwirkende Sonnenstrahlung zu Sonnenbränden, vorzeitiger Hautalterung sowie Hautkrebs führen kann“, startete Berneburg. Umso wichtiger sei es, die Haut durch präventive Maßnahmen zu schützen.
In einer Studie wurden 1.621 Einwohner aus Nambour, Australien, im Hinblick auf die Verwendung von Sonnenschutzmitteln beobachtet. Es wurde ihnen freigestellt, ob sie Sonnenschutzmittel verwenden, wie oft und wie viel. Die Probanden wurden vier bis fünf Jahre beobachtet. Die Untersuchung zeigte, dass jene Probanden, die täglich Sonnenschutz verwendet hatten – und sei
es nur ein Lichtschutzfaktor von UV 15 – signifikant seltener an einem Spinalzellkarzinom erkrankten als jene, die keinen Sonnenschutz auftrugen. [1] Zusätzlich ließ sich beobachten, dass Probanden, die keinen Sonnenschutz verwendet hatten, eine deutliche Zunahme an malignen Melanomen aufwiesen. Als die Probanden in der nächsten Phase den Sonnenschutz wieder verwenden konnten wie sie wollten, ging die Differenz der beiden Gruppen trotzdem noch weiter auseinander. [2] „Der Nutzen, der durch das Verwenden von Sonnenschutzmitteln erzielt wird, hält nicht nur im Verwendungszeitraum, sondern auch darüber hinaus an, sodass ein langfristiger protektiver Nutzen besteht“, erklärte der Experte.
UVA- und UVB-Strahlen: essenzieller Unterschied
Wenn über UV-Strahlen gesprochen wird, muss zwischen UVA- und UVB- Strahlen unterschieden werden. Im Gegensatz zu UVA-Strahlen dringen UVB-Strahlen nicht so tief in die Haut ein, wodurch sie nur in den oberen Hautschichten ihre biologische Wirkung und direkte DNS-Schäden hervorrufen. UVA-Strahlen dringen deutlich tiefer in die Haut ein und spielen, ebenso wie UVB-Strahlung, eine wesentliche Rolle in der Tumorbildung der Haut, z.B. beim malignen Melanom. „Risikofaktoren für die Bildung eines malignen Melanoms sind: heller Hauttyp, Sonnenbrände, vor allem in der Kindheit, und eine hohe Anzahl von Nävi sowie Vorhandensein dysplasti- scher Nävi“, so Berneburg.
In der Melanom-Forschung untersucht man schon länger, wie es zur Melanombildung kommt. „Wir wissen, dass Melanome häufig de novo entstehen. Tödlich sind dabei meist die sich bildenden Metastasen. Die Frage ist, ob die Progression des Melanoms zur Metastase sequenziell erfolgt und somit immer über den Lymphknoten geht oder nicht“, so der Experte. Analysen zeigten jedoch, dass die Entstehung eines metastasierten Melanoms nicht zwingend sequenziell ist, da die Mutationen und die Mutationslast sich anders entwickelt hat als in der frühen Melanomphase. [3] „Wenn die Metastasierung nicht sequenziell ist, müssen wir uns fragen, welche Rolle die UV-Strahlung bei der Induktion der Metastasierung spielt“, merkte der Experte an. Infolgedessen stellt sich folgende Frage: Wenn bereits ein Melanom aufgetreten ist, lohnt sich dann noch Sonnenschutz oder ist es bereits zu spät?
In einer weiteren Studie wurden die verschiedenen Wellenlängen unter- sucht, wobei die UVA-Strahlung im Fokus stand. Dreimal täglich wurden bestimmte Hautbereiche repetitiv in subletalen Dosen bestrahlt. Es konnte festgestellt werden, dass es bei Betrachtung der radiellen und metastasierten Wachstumsphase einen großen Unterschied zwischen bestrahlter und nicht bestrahlter Haut gab. Das heißt, UVA-Strahlung induziert metabolische Prozesse unterschiedlichster Art. Auch die Invasivität konnte induziert werden, wenn noch nicht metastasierte Zellen bestrahlt wurden. Zusätzlich konnte statistisch signifikant gezeigt werden, dass die Anwendung von Sonnenschutzmitteln mit hohem Sonnenschutz, sowohl für UVA als auch für UVB, tatsächlich den Metabolismus reduziert und somit vor diesen negativen Effekten schützen kann. [4] Letztlich konnte festgestellt werden, dass Sonnenschutz nicht nur einen präventiven, sondern auch einen progressiven Einfluss auf die Haut hat. Aufgrund dessen ist es sinnvoll, dass Patienten, bei denen bereits ein malignes Melanom aufgetreten ist, weiterhin Sonnenschutz verwenden [4].
Sonnenschutz: vernachlässigte Adhärenz
In einer randomisierten, kontrollierten Machbarkeitsstudie sollten die Compliance und Anwendungshäufigkeit von Sonnenschutz und die Lebensqualität bei Patienten mit Melanom im Stadium I oder II untersucht werden. [5] Es konnte beobachtet werden, dass die Patienten der Interventionsgruppe 2,6 mg ± 2,0 mg Sonnenschutzcreme verwendeten, was einer maximalen Applikation von 1,4 mg/cm2 auf einer realistischen Körperoberfläche entspricht. Ein Wert von 1,4 mg liegt allerdings deutlich unterhalb des von der S3- Leitlinine der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft empfohlenen Sonnenschutzes von 2 mg/cm2. Eine häufigere Anwendung konnte festgestellt werden, wenn der UV-Index erhöht war. Die Interventionsgruppe neigte zu häufigeren Anwendungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. [5]
„Ein hoher UVA-/UVB-Schutz wird dringend empfohlen, um UV-induzierte Hautschäden effizient zu minimieren“, mahnte Berneburg. Umso wichtiger sei es, an dieser Stelle anzusetzen und mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn häufig werde die kontinuierliche und angemessene Anwendungvon Sonnenschutzmitteln von der Bevölkerung stark unterschätzt, obwohl Sonnenschutz die Entstehung von Melanomen und weiterer Hautkrebsarten verhindern kann.
Sonnenschutz und Vitamin D
Welchen Einfluss Sonnenschutz auf die Vitamin D-Bildung hat, ist umstritten. Meta-Analysen konnten zeigen, dass Sonnenschutz die Vitamin D-Serumwerte sowohl erhöhen als auch senken kann. Eine klare Tendenz lässt sich demnach noch nicht erkennen. [6,7] Son- nenschutzcremes mit höherem UVA-Schutz können eventuell die Vitamin-D-Produktion zulassen. Sollte jedoch ein Vitamin D-Mangel erkannt werden, kann bei Bedarf substituiert werden.
Quelle: Mittagssympposium: „Update 2021: Prävention im Fokus – Hautkrebs vorbeugen und bei Neurodermitis das Mikrobiom stärken“ im Rahmen des 51. DDG-Kongresses, 17. April 2021; Veranstalter: La Roche Posay
Literatur
1. Green A et al. Lancet. 1999; 354:723-729
2. Green A et al. J Clin Oncol. 2011; 29:257-263
3. Werner-Klein M et al. Nat Commun. 2018;9:595
4. Kamenisch et al. J Invest Dermatol. 2016;136(9):1866-1875
5. Goeth H et al. BJD. 2020; 183(6):1132-1134
6. Neale R et al. Br J Dermatol. 2019;181(5):907-915
7. Young A et al. Br J Dermatol. 2019;182(5):1313-1314