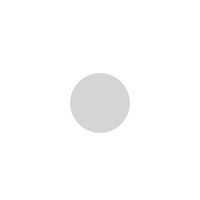Rheuma und Depression: Wie kann der Rheumatologe dieser Komorbidität begegnen?
Die Depression ist mit einer geschätzten Prävalenz von vier Millionen Menschen in Deutschland die häufigste psychische Erkrankung. Sie kann nach neueren Erkenntnissen sowohl Verlauf und Therapie anderer Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis negativ beeinflussen als auch durch diese hervorgerufen bzw. verstärkt werden. Diese Komorbidität sollte daher in der Rheumatologie weder diagnostisch noch therapeutisch vernachlässigt werden.
Hauptsymptome depressiver Episoden nach den ICD-10-Kriterien sind depressive Stimmung über die meiste Zeit des Tages, Verlust von Interesse und Freude sowie Müdigkeit bzw. Ermüdbarkeit. Hinzu kommt eine Reihe von Nebensymptomen wie verminderte Konzentration, Schuldgefühle, Suizidgedanken und Schlaf- sowie Appetitstörungen. Eine wesentliche Ursache für Depressivität können Entzündungen im Körper sein, die sich über psychoneuroendokrine Kommunikation, vermittelt durch Immunzellen, negativ auf das Nervensystem auswirken, berichtete
Dr. Jörg Wendler, niedergelassener Rheumatologe aus Erlangen, bei einer Session im Rahmen des 49. DGRh- Kongresses. Nach den Ergebnissen der COMORA-Studie [1] ist die Depression mit einer Häufigkeit von etwa 15% sogar eine der wesentlichen Komorbiditäten bei rheumatoider Arthritis (RA) (s. Abb. 1). Diesen Zusammenhang hat daraufhin eine Arbeitsgruppe deutscher Rheumatologen in den Studien VADERA I und II ausführlich untersucht.
VADERA I [2] widmete sich zunächst der Validierung eines Messinstruments für Depressivität. Als geeignetes Hilfsmittel zu deren Erfassung erwies sich dabei der PHQ-9-Fragebogen (Patient Health Questionnaire 9), der über neun Fragen alle Haupt- und fünf Nebensymptome der Depression adressiert und ohne Lizenzgebühren frei verfügbar ist. Die anschließende multizentrische Querschnittstudie VADERA II [3] erfasste Häufigkeit und Schweregrad signifikanter depressiver Symptome bei über 1.000 RA-Patienten mittels des PHQ-9. Eine klinisch relevante, moderate bis schwere Depression fand sich hier immerhin bei 22,8% der 1.004 Teilnehmer. Eine frühere Meta-Analyse [4] hatte sogar eine Häufigkeit von 16,8% schwerer Depressionen (major depressive disorder) und eine Prävalenz depressiver Symptome bei 38,8% der RA-Patienten ermittelt.
Die praktische Relevanz dieser Befunde wird für Wendler auch dadurch unterstrichen, dass bei Patienten mit anhaltender Depression in mehreren Studien nicht nur erhöhte Werte des DAS28 (disease acticity score) sondern auch eine erhöhte Krankheitsaktivität, geringere Remissionsraten und – bei schweren depressiven Symptomen – sogar eine erhöhte Gesamtmortalität gefunden wurden. [5] Ausgeprägt depressive RA-Patienten wiesen zudem auch hinsichtlich des objektiven Messparameters CRP höhere Werte auf als Rheumatiker ohne Depression.
[6] Ähnliche, signifikante Befunde liegen auch für Patienten mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) vor, so Wendler weiter. Zugleich wirkt sich eine Depression aber auch negativ auf den rheumatologischen Therapieerfolg mit Biologika aus, wie eine britische Registerstudie anhand der Abnahme des DAS28 ermittelt hat. [7] Damit übereinstimmend hatten auch in VADERA II depressive Patienten mit 16% deutlich seltener eine Remission (EULAR Boolean remission) unter Therapie als Patienten ohne diese Komorbidität (37%). Bemerkenswerterweise waren jedoch nur 11,7% der depressiven RA-Patienten unter einer antidepressiven Therapie.
Kann der Rheumatologe die Depression in der täglichen Praxis berücksichtigen?
Als einfaches Instrument zur raschen Erfassung depressiver Symptome sieht Wendler den PHQ-2, eine Kurzform des PHQ-9, bei der solche Symptome bereits durch zwei Fragen erfasst und auf einer Skala von 0-6 quantifiziert werden. Im Vergleich zu einem strukturierten klinischen Interview ließ sich in einer eigenen Untersuchung bei einem gemischten Kollektiv von 485 Patienten mit verschiedenen rheumatischen Erkrankungen durch Ergänzung der rheumatologischen Diagnostik mit dem PHQ-2 bei einem ermittelten PHQ-2-Wert > 3 bereits eine Sensitivität von 87% und eine Spezifität von 78% für die Erkennung einer schweren Depression (major depressive disorder) [8] ermitteln.

Abb. 1: Komorbiditäten bei rheumatoider Arthritis. (Quelle: mod. nach [1]
Der Einfluss einer alleinigen antiinflammatorisch wirkenden rheumatologischen Therapie auf die Depression ist allerdings sehr moderat, wie eine Meta-Analyse zu antidepressiven Effekten einer Anti-Zytokintherapie ergeben hat. [9] „Eine effektive Pharmakotherapie der Entzündung bei rheumatoider Arthritis reicht bei weitem nicht aus, um eine Depressivität günstig zu beeinflussen“, resümierte Wendler dieses Resultat. Ein Rheumatologe sollte nach seiner Auffassung seine Patienten jedenfalls bezüglich dieser Ko Literatur morbidität screenen und zusätzlich zur antiinflammatorischen Therapie über eine ggf. ermittelte Depression sowohl mit dem Patienten als auch mit dem Hausarzt kommunizieren. Als hilfreich hat sich in seiner eigenen Praxis dabei ein funktionierendes Netzwerk erwiesen, in dem neben dem Hausarzt idealerweise als Ansprechpartner auch psychologische Psychotherapeuten, Nervenarzt/Psychiater oder eine psychosomatische/psychiatrische Klinikambulanz zur Verfügung stehen, so der Rheumatologe abschließend.
Quelle: Session 15 „RA und ihre Komorbiditäten“ beim 49. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh), 16. September 2021
1. Dougados M et al., Ann Rheum Dis 2014; 73:62-68
2. Englbrecht M et al., Arthritis Care Res 2017; 69(1):58-66
3. Englbrecht M et al., PLOS ONE 2019;14(5):e0217412
4. Matcham F et al., Rheumatology (Oxford) 2013;52(12):2136-2138
5. Kleinert S et al., Prävalenz und Rrelevanz von depressiven Symptomen bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. DGRh 2015
6. Isnardi CA et al., J Clin Rheumatol 2020, doi: 10.1097/RHU.0000000000001506 Epub ahead of print. PMID 327325221
7. Matcham F et al., Rheumatology (Oxford) 2018;57(5):835-843
8. Kleinert S et al., How many of your patients have depressive symptoms? How to assess during routine clinical practice? EULAR 2019
9. Kappelmann N et al., Molecular Psychiatry 2018;23:335-343