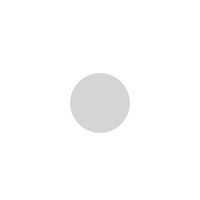Eine in-vitro-Studie Guido Schröder (1), Claus Maximilian Kullen (2), Julian Ramin Andresen (3), Marko Schulze (4), Laura Hiepe (4), Hans-Christof Schober (5), Reimer Andresen (2) KlinikfürOrthopädieundUnfallchirurgie,WarnowKlinikBützow,Bützow InstitutfürDiagnostischeundInterventionelleRadiologie/Neuroradiologie,WestküstenklinikumHeide,Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg, Heide MedizinischeFakultät,SigmundFreudPrivatuniversität,Wien InstitutfürAnatomie,UniversitätsmedizinRostock,Rostock KlinikfürInnereMedizinIV,KlinikumSüdstadtRostock,AkademischesLehrkrankenhausderUniversitätRostock,Rostock Das Risiko für osteoporotische Insuffizienzfrakturen am Achsenskelett steigt mit zunehmender Abnahme der Knochendichte, wobei sich thorakal und thorakolumbal